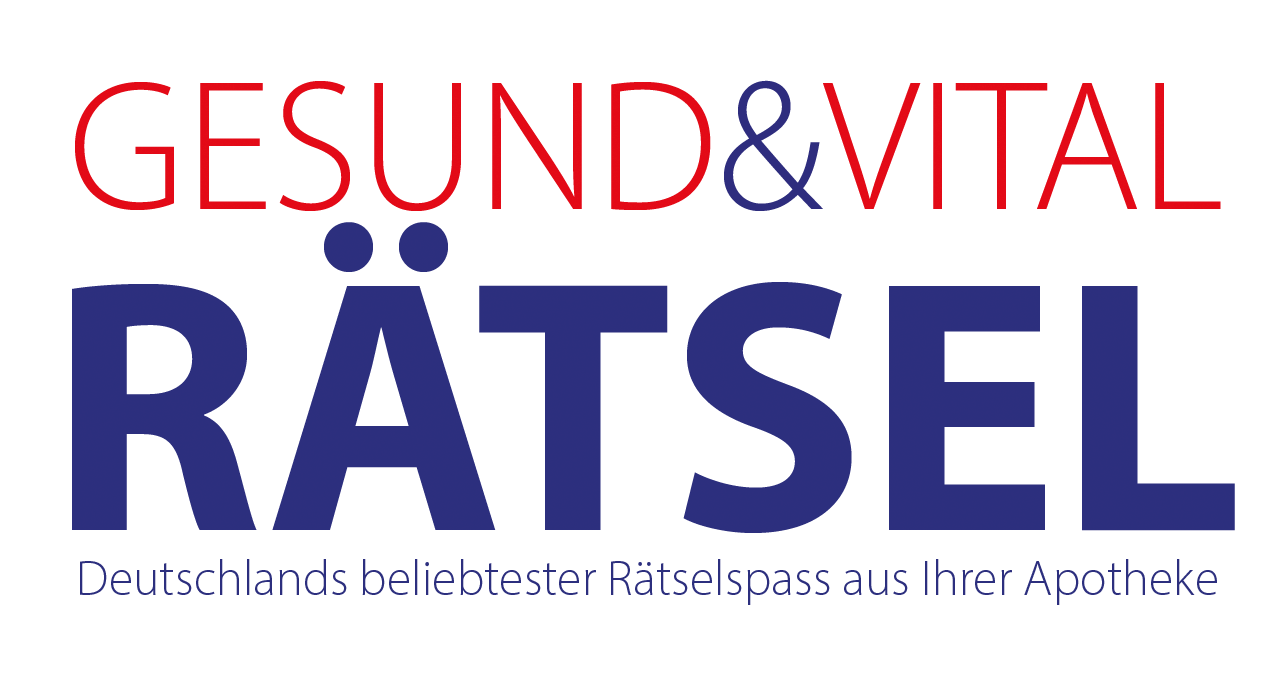Das Verbrauchsverfallsdatum – sinnvolle Ergänzung zum Mindesthaltbarkeitsdatum

Ein großes Problem unserer Wohlstandsgesellschaft ist die Verschwendung von Nahrungsmitteln. Vielen Menschen fällt es schwer, all die eingekauften Lebensmittel zu genießen, bevor deren Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht wird. Also wandern Joghurts, Saucen und andere Sachen in den Mülleimer. Das Problem daran: Das Mindesthaltbarkeitsdatum gibt nicht den Zeitpunkt an, zu dem ein Produkt verdirbt und ungenießbar wird, sondern eben jene Zeitspanne, innerhalb derer ein Lebensmittel ungeöffnet und bei richtiger Lagerung bestimmte Eigenschaften beibehält. Was wir wegwerfen, ist also größtenteils noch „gut“. Um dieser Verschwendung Einhalt zu gebieten, plant das Ernährungsministerium eine Alternative zum Mindesthaltbarkeitsdatum: das Verbrauchsverfallsdatum.
Jedes Jahr wirft jeder Bundesbürger sein Eigengewicht an Lebensmitteln in den Mülleimer. Das sind in etwa zwei volle Einkaufswagen, gute 80 Kilogramm, circa 250 Euro, oder jedes zweite Lebensmittel. Darunter sind zwar besonders viel Obst, Gemüse und Backwaren, doch auch verpackte Nahrung wandert in die Tonne – in vielen Fällen nicht etwa weil der Inhalt wirklich schlecht geworden wäre, sondern weil schlicht und ergreifend das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten wurde. Denn das wird von vielen Verbrauchern fälschlicherweise als ein Verfallsdatum interpretiert. In der Realität benennt es jedoch lediglich das Datum, bis zu dessen Erreichen die Produzenten des Lebensmittels einen bestimmten Geruch und Geschmack, eine Farbe, Form und Konsistenz garantieren. Und weil die Produzenten keine Lust auf Beschwerden oder gar Klagen haben, kalkulieren sie einen mehr oder weniger großen Zeitpuffer mit ein. Schmackhaft und genießbar bleibt das Produkt jedoch noch sehr viel länger.
Ein Nebeneinander von MHD und Verbrauchsverfallsdatum?
Der Bundesernährungsminister Christian Schmidt (CSU) findet, das müsse nicht sein. Deshalb fordert er „intelligente“ Verpackungen, die dem Konsumenten tatsächlich anzeigen, ob die Nahrungsmittel noch genießbar sind. Eine Möglichkeit wäre, Produkte neben dem bereits bekannten und verwendeten Mindesthaltbarkeitsdatum ebenfalls mit einem neuartigen Verbrauchsverfallsdatum zu versehen. Dieses neue Datum solle zusammen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum einen Zeitkorridor aufzeigen, innerhalb dessen ein Lebensmittel noch bedenkenlos konsumiert werden kann. Im Grunde wäre ein Mindesthaltbarkeitsdatum dann teilweise oder sogar ganz (z.B. bei ohnehin haltbaren Lebensmitteln wie Nudeln oder vakuumverpacktem Kaffee) überflüssig.
Ein Verbrauchsverfallsdatum bedeutet eine Kostensteigerung für alle
Ein Verbrauchsverfallsdatum ließe sich besonders bei industriell und nach immer gleichen Standards hergestellten Produkten relativ leicht kalkulieren. Doch mit seiner Idee der „intelligenten Verpackung“ möchte Schmidt noch einen Schritt weiter gehen. Deren Umsetzung würde allerdings nicht nur einen größeren Produktionsaufwand und steigende Produktionskosten für die Hersteller bedeuten, sondern vermutlich auch einen höheren Preis für den Endverbraucher – und den können oder wollen viele Konsumenten einfach nicht bezahlen. Denn wie soll eine „intelligente Verpackung“ aussehen? Schmidt schweben da Joghurtverpackungen samt Mikrochip vor, die per Farbskala anzeigen, ab wann der Joghurt wirklich verdorben ist und nicht mehr verzehrt werden sollte. Eine weitere Möglichkeit wäre ein Gasgemisch, dass beispielsweise in die Verpackungen von Fisch- oder Fleischwaren eingebracht werden könnte. Beim Verderben des jeweiligen Produkts verändert das Gas seine Farbe und der Verbraucher weiß, ob er das Lebensmittel noch essen sollte. Da die meisten Lebensmittel aber unterschiedliche Zerfallsprodukte erzeugen, die erst erfasst, gemessen und dann durch verschiedene Detektoren messbar bzw. sichtbar gemacht werden müssten, steht am Anfang dieser Entwicklung eine umfangreiche Vorarbeit und Kosten.
Intelligente Verpackungen generieren mehr Müll
Wie schon erwähnt, handelt es sich bei einem großen Teil der weggeworfenen Lebensmittel um Gemüse, Obst und Backwaren. Und solche Produkte sind meist kaum oder gar nicht verpackt. Müsste man Verbrauchern nun verbindlich ein Verbrauchsverfallsdatum nennen – eventuell gar in Form einer intelligenten Verpackung mit Mikrochip oder Gasgemisch – so würde man zwangsläufig auch eine größere Menge Müll generieren. Diesmal keinen Biomüll mehr, sondern Verpackungsmüll. Zwar wird solcher Verpackungsmüll in Deutschland zu einem bedeutenden Teil wiederverwertet, doch auch das benötigt letztlich Energie. Sollte man eine geringere Verschwendung von Lebensmitteln also mit einer größeren Belastung für die Umwelt erkaufen?
Viel hängt von der Eigenverantwortung der Konsumenten ab
Unabhängig davon, ob die Verbraucher nun ein Mindesthaltbarkeitsdatum, ein Verbrauchsverfallsdatum, oder gar beides prüfen können, liegt es doch letztlich an ihnen, ihren Konsum zu steuern. Sie sollten in der Lage sein, vorausschauend einzukaufen und die erworbenen Produkte innerhalb einer absehbaren Zeitspanne, die bereits durch das meist nicht sehr knapp bemessene Mindesthaltbarkeitsdatum definiert wird, zu verzehren. Und wenn dieses Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, kann man – in einem gewissen Rahmen – immer noch auf seinen Geruch-, Seh- und Geschmacksinn zurückgreifen. Letztlich kommt es nämlich nicht darauf an, den mündigen Konsumenten immer mehr Informationen zur Verfügung zu stellen, sondern ihnen beizubringen, die Informationen, die sie bereits haben, auch zu verwerten. Gelingt das nicht, wird es wohl bald zur automatischen Selbstzerstörung abgelaufener Produkte kommen müssen.