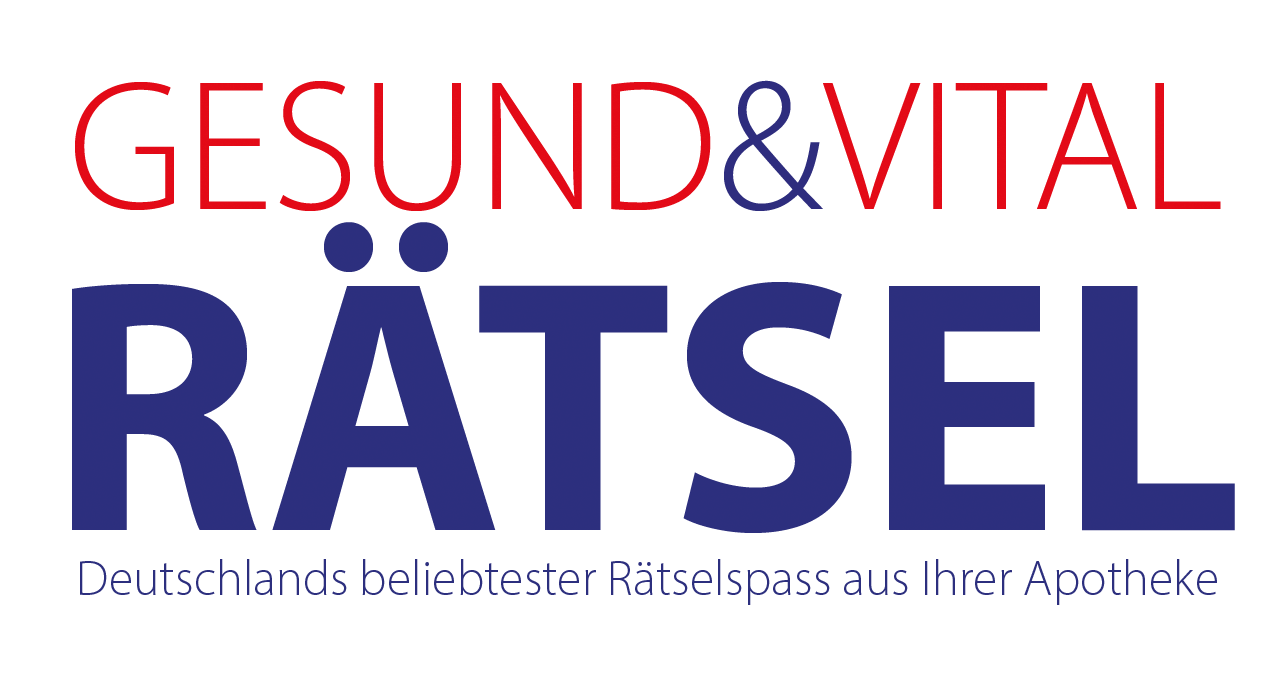Positronen-Emissions-Tomographie (PET)
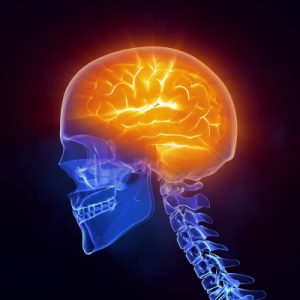
Teil 1
Die Positronen-Emissions-Tomographie (PET)
Ein noch relativ neues Diagnoseverfahren speziell in der intensiv-medizinischen Behandlung der Onkologie bildet die Positronen-Emissions-Tomographie (PET). Sie liefert vor allem in der Krebsfrüherkennung höchst differenzierte Aufnahmen innerer Krankheitsherde, kann im Gegensatz zu anderen Verfahren auch Aufschluss über die Bösartigkeit von Wucherungen geben, da sie direkt den Arbeitsablauf einzelner Körperzellen im Visier hat.
‚Positronenstrahler’ (Tracer), d.h. radioaktiv markierte Substanzen, werden dem Patienten etwa eine Stunde vor der Positronen-Emissions-Tomographie (PET) verabreicht, z.B. die F18-Desoxyglukose (FDG), ein mit radioaktivem Fluor markiertes Traubenzuckermolekül, das normal verstoffwechselt wird. Beim Zerfall der Strahler werden Energien frei, welche von Detektoren registriert werden, während der Patient auf einer Liege schrittweise durchs Gerät geschoben wird. Eine Kamera mit daran angeschlossenem Rechner erstellt auf dieser Basis mehrdimensionale Bilder des Körperinnern im Hell-Dunkel-Kontrast. Bei einer PET, meist in Kombination mit einer CT, heben sich in den Aufnahmen bereits millimetergroße Wucherungen bösartiger Zellen deutlich als helle Flecken vom restlichen Gewebe ab, da diese in der Regel über einen intensiveren Traubenzuckerverbrauch verfügen und sich das FDG dort mehr anreichert.
Mit einer Positronen-Emissions-Tomographie (PET) kann so z.B. bereits innerhalb einer Stunde Lage, Ausdehnung, Malignität und Stadium eines Tumors recht gut (mit bis zu 90%iger Genauigkeit) und vor allem früh erkannt werden. Umso passgenauer werden dann auch Therapiemaßnahmen planbar. Dies macht das ansonsten kostenintensive Verfahren rentabel, weil erst dadurch vielleicht andere aufwändige Untersuchungen, mitunter sogar mehrere operative Eingriffe, vermieden werden können. Bei der Nachsorge wird eine Neubildung von Tumorgewebe frühzeitiger erkennbar, bereits wenige Wochen nach einer Behandlung.
Die Strahlenbelastung bei der Positronen-Emissions-Tomographie (PET) ist äußerst gering, da die Tracer über eine extrem kurze Halbwertzeit verfügen und auch in kleinen Mengen eine zuverlässige Aussage liefern.
Neben der Krebsdiagnose wird die PET auch erfolgreich bei Herz- und Nervenerkrankungen angewandt.
Teil 2
Mit Sicht auf den Kosmos der Zelle:
die Positronen-Emissions-Tomographie (PET) Teil 2
Bei der Bekämpfung schwerer Krankheiten haben bekanntlich Neuerungen bei Diagnose- und Therapieverfahren einen hohen Stellenwert. Erst seit wenigen Jahren wird z.B. die noch kostenintensive ‚Positronen-Emissions-Tomographie’ (PET) in der klinischen Tumordiagnostik intensiv genutzt. Sie liefert höchst differenzierte Aussagen bei der Krebsfrüherkennung, meist wesentlich besser als z.B. die ‚Computertomographie’ (CT) und die ‚Magnet-Resonanz-Tomographie’ (MRT), denn sie gibt Aufschluss über die Funktionsweise der Körperzellen. Oft wird die PET aber mit den anderen Verfahren kombiniert (z.B. PET-CT), um Lage und Ausdehnung, vor allem aber Bösartigkeit, Metastasierung und Stadium eines Tumors bestimmen zu können. Denn nur so kann letztlich auch ein optimaler Therapieerfolg begründet werden.
Diagnose mit Sichtung der Zellfunktion
Bei der PET kommen so genannte ‚Positronenstrahler’ (Tracer) zum Einsatz. Das sind radioaktiv markierte Substanzen wie z.B. die bewährte F18-Desoxyglukose (FDG), ein mit radioaktivem Fluor markiertes Traubenzuckermolekül. Dieses wird in den Zellstoffwechsel eingeschleust und bis zu einem gewissen Grad wie ein normales Glucosemolekül abgebaut, welches als zentrale Substanz in den meisten Zellen zu finden ist. Beim Zerfall der Positronenstrahler werden zwei Energieteilchen frei, welche, in zwei entgegen gesetzte Richtungen ausstrahlend, eine Linie entstehen lassen, die mit anderen Strahlerlinien die Basis bildet für ein komplexes dreidimensionales Bild, das eine PET-Kamera mit daran angeschlossenem Rechner erstellt, während der Patient langsam durchs Gerät geschoben wird.
Auf diese Weise kann bereits innerhalb einer Stunde die gesamte Tracerverteilung im Körper ermittelt werden. Da nun Tumorzellen mit entartetem Wachstum einen in der Regel stark erhöhten Traubenzuckerverbrauch aufweisen und sich deshalb das FDG vermehrt in ihnen anreichert, heben sie sich im hell-dunkel kontrastierten PET-CT-Bild bereits als millimetergroße helle Flecken deutlich gegenüber gesunden Zellen ab.
Geringe Belastung für den Patienten
Mit einer PET-Untersuchung haben Patienten in der Regel weniger Probleme als mit anderen Diagnosemethoden. Etwa eine Stunde vor der Aufzeichnung auf der Kameraliege bekommen sie den Tracer verabreicht. Dessen Strahlenbelastung ist für den Körper äußerst gering, da er über eine extrem kurze Halbwertzeit verfügt, d.h. Zeit, in der sich die Strahlung bis zur Hälfte ihrer Aktivität verringert. Außerdem macht der Tracer bereits in sehr geringen Mengen das sichtbar, was sichtbar werden muss. Dadurch kommt es zu keinerlei ‚Überdosierung’. Die Untersuchung selbst geht für den Patienten unspektakulär vor sich. Er muss sich lediglich ruhig verhalten, wenn die PET-Kamera mithilfe eines Scannerrings oder den Patienten umkreisenden Detektorköpfen ihre Aufnahmen macht.
Viele Vorteile trotz erhöhter Kosten
Frühzeitig genaue Diagnosen und Therapien können bei bösartigen Tumoren Leben retten. Eine Veränderung im Glukosestoffwechsel wird sofort sichtbar. Der Nachweis von Malignität ist mit anderen Verfahren auf diese Weise oftmals gar nicht möglich. In diesem Sinne zahlt sich die nach wie vor kostenintensive PET aus. Denn erst dadurch können vielleicht andere aufwändige Untersuchungen, mitunter sogar Operationen, vermieden werden. Bei der Nachsorge bzw. Verlaufskontrolle einer Tumorerkrankung gewährleistet sie eine frühzeitige Erkennung von Krebsneubildungen. Bereits zwei Wochen nach einer Chemotherapie lässt sich z.B. überprüfen, ob die Behandlung erfolgreich war oder nicht. So können auch schneller Folgemaßnahmen getroffen werden.
Neben der Krebsdiagnose ist die PET übrigens auch in der Kardiologie und Neurologie nicht mehr wegzudenken. Und sie ist normalerweise eine Regelleistung privater Krankenversicherer, wird aber ebenso von den gesetzlichen Kassen nach einem Genehmigungsverfahren gewährleistet.